KI-Governance wird zur Überlebensfrage: Versicherer riskieren mehr als Bußgelder
Ein und derselbe Schaden – zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen. Was dazwischenliegt? Eine KI. Dieses reale Beispiel zeigt: ChatGPT verändert das Machtverhältnis im Versicherungswesen. Wer nicht mitzieht, verliert mehr als nur die Kontrolle.

Ein Versicherungsnehmer reicht eine Schadensforderung ein – sie wird abgelehnt. Zwei Stunden später kommt dieselbe Forderung erneut. Diesmal juristisch präzise formuliert, argumentativ stark und so überzeugend, dass der Versicherer zustimmt. Der Unterschied? Nicht der Sachverhalt – sondern der Einsatz von ChatGPT. Die Szene ist real – und sie markiert einen Wendepunkt im Machtgefüge zwischen Versicherer und Versichertem.

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur interne Prozesse – sie verändert das gesamte Marktverhältnis. Versicherer stehen Kund:innen gegenüber, die nicht mehr nur vergleichen, sondern mit denselben Technologien agieren wie die Anbieter selbst. In diesem neuen Gleichgewicht wird Governance zur strategischen Pflicht. Denn wer KI einsetzt, ohne deren Konsequenzen zu kontrollieren, riskiert mehr als Bußgelder: Er riskiert das Vertrauen seiner Kund:innen – und damit seine Daseinsberechtigung.
Die technische Überlegenheit wechselt die Seite
„KI ist nicht mehr nur ein Werkzeug der Versicherer, auch Kundinnen und Kunden nutzen sie, um sich auf Augenhöhe zu positionieren“, warnt Martin Thormählen, CTO von Munich Re. Während Versicherer versuchen, Prozesse zu beschleunigen und Entscheidungen zu automatisieren, nutzen immer mehr Versicherte generative KI, um Forderungen, Widersprüche oder Leistungsansprüche rechtlich belastbar zu formulieren.
Diese Entwicklung macht sichtbar, wie schmal der Grat zwischen Automatisierung und Vertrauensverlust geworden ist. Monika Sebold-Bender, unabhängige Aufsichtsrätin mehrerer Versicherer, bringt es auf den Punkt: „Wenn wir Schäden wegen Formalien ablehnen, verlieren wir Vertrauen, und damit Kunden.“
Der technologische Fortschritt hat die Kommunikationsasymmetrie aufgehoben – und macht ethische wie regulatorische Leitplanken dringlicher denn je.
Governance muss der Technik vorausgehen
„Nicht jeder automatisierte Prozess ist ein Fortschritt. Wir dürfen uns nicht von Effizienzgewinnen blenden lassen“, sagt Thormählen. KI-Governance ist in dieser neuen Realität kein Add-on mehr, sondern eine Voraussetzung für jeden produktiven Einsatz. Die ethische, rechtliche und organisatorische Absicherung von KI-Systemen muss vor der technischen Implementierung stehen – nicht umgekehrt.
Das bedeutet: Wer heute ein KI-Modell einführt, braucht ein Framework, das nicht nur den Output validiert, sondern bereits die Datenquellen, Modelllogiken und Entscheidungsrechte sauber dokumentiert. Governance muss konkret sein, nicht abstrakt: Wer trägt Verantwortung bei Fehlentscheidungen? Wo greifen menschliche Kontrollmechanismen? Wie wird dokumentiert, wie KI zu ihren Ergebnissen kam?
Eine häufig unterschätzte Komponente: Die kritische Urteilskraft der Mitarbeitenden. „Trust Bias ist real. Nur weil die KI zehnmal richtig lag, heißt das nicht, dass sie beim elften Mal nicht irrt“, so Thormählen. Governance beginnt nicht bei der Technik – sondern beim Denken über Technik.
Vertrauen ist kein Nebenprodukt – sondern ein Wettbewerbsvorteil
Trotz aller Risiken zeigt sich ein positiver Trend: Das Vertrauen in Versicherer steigt. Der Anteil der Kund:innen, die ihre Versicherung als notwendig, aber lästig empfinden, ist laut einer aktuellen Verbraucherstudie von Guidewire von 36 % auf 30 % gefallen. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die sich verstanden fühlen und die Produkte schätzen, auf 32 % gestiegen. Im Ländervergleich liegt Deutschland mit 38 % an der Spitze beim Vertrauen in Versicherer .
Das ist eine historische Chance. Denn während technologische Innovationen oft abstrakt und erklärungsbedürftig sind, ist verantwortungsvoller KI-Einsatz kommunikativ aufladbar. Wer glaubwürdig darlegt, wie er mit KI umgeht, wo er Grenzen zieht und warum bestimmte Entscheidungen nicht automatisiert werden, kann sich als fairer Partner positionieren – und Kund:innen langfristig binden.
Handlungsempfehlungen für Versicherer
1. AI-Governance-Framework einführen
Definiere ethische, rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen, bevor KI produktiv eingesetzt wird. Klare Entscheidungsprozesse, Kontrollinstanzen und dokumentierte Verantwortlichkeiten sind unerlässlich.
2. Kritikfähigkeit im Unternehmen stärken
Setze nicht nur auf Tools, sondern auf Denkvermögen. Schulungen sollten nicht nur Nutzung, sondern auch Bewertung und Infragestellung von KI-Ergebnissen fördern. Sensibilisierung für „Trust Bias“ gehört zur Governance-Praxis.
3. Vertrauenskommunikation strategisch nutzen
Nutze das steigende Kundenvertrauen aktiv – durch transparente Kommunikation über den Umgang mit KI, konkrete Beispiele verantwortlicher Anwendung und den Dialog mit kritischen Kund:innen.
Ausblick
Die erfolgreiche Navigation durch das KI-Zeitalter erfordert mehr als technische Exzellenz – sie verlangt nach einer ausgewogenen Balance zwischen Innovation und Verantwortung. Versicherer, die diese Balance ernsthaft gestalten, überwinden nicht nur regulatorische Hürden. Sie gewinnen etwas weit Wertvolleres: das Vertrauen informierter Kund:innen in einer digital selbstbewussten Gesellschaft.
Quellen:
[1] https://www.thebrokernews.ch/zwischen-vertrauen-und-technik-ki-governance/
[3] https://www.ivw.unisg.ch/de/ivw-event/save-the-date-future-talk-2-2025/

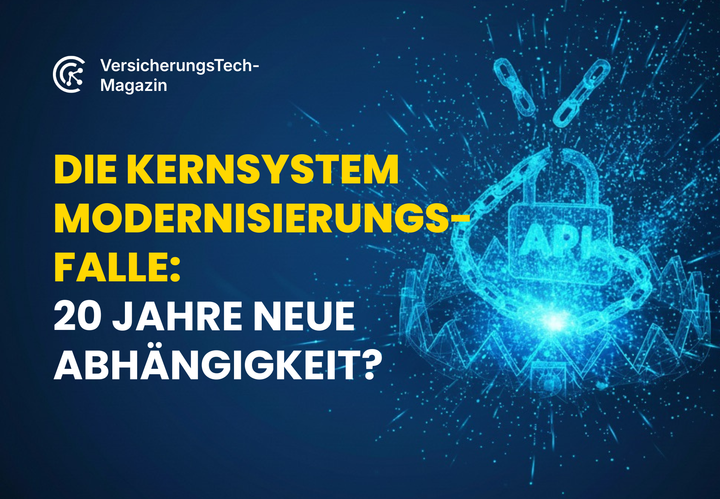
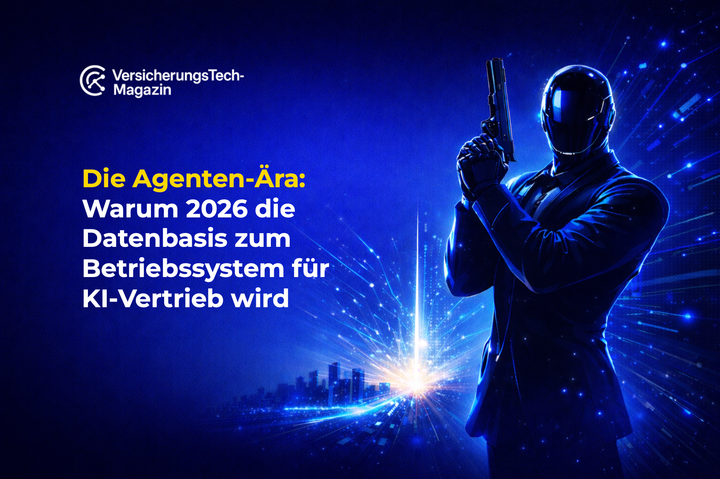
Kommentare ()